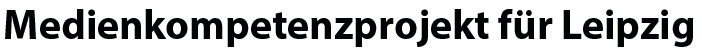Influencer:innen sind aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken. Ob auf Instagram, TikTok oder YouTube: Sie prägen Trends, setzen Themen und beeinflussen Entscheidungen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff „Influencer:in“? Wie wirkt sich dieser Einfluss auf uns und besonders auf junge Menschen aus und wo wird es problematisch?
Wer sind eigentlich Influencer:innen?
Der Begriff leitet sich vom englischen to influence ab, was „beeinflussen“ bedeutet. Und genau das ist ihr Markenzeichen: Influencer:innen wirken auf ihre Community ein. Sie produzieren regelmäßig Inhalte, geben Empfehlungen, teilen Meinungen und erreichen damit oft ein riesiges Publikum.
Ihre Themen reichen von Mode über Politik bis zu Alltagsfragen und genau darin liegt ihr Einfluss: Sie schaffen Nähe, Orientierung und Identifikation. Besonders junge Menschen empfinden sie als glaubwürdig und authentisch, teilweise sogar vertrauenswürdiger als klassische Medien oder Werbung.
Warum folgen wir Influencer:innen?
Die Gründe sind vielfältig: Viele Menschen suchen bei ihnen Unterhaltung und Inspiration, andere schätzen den Informations- und Wissensgewinn. Häufig spielt auch das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit eine Rolle. Hinzu kommen Vertrauen und Authentizität, die den Eindruck verstärken, dass Empfehlungen ehrlich gemeint sind. Nicht selten sehen Follower in Influencer:innen Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können.
Das Zusammenspiel all dieser Faktoren führt dazu, dass Influencer:innen nicht nur Produkte empfehlen, sondern als Meinungsführer:innen agieren. Ein Konzept, das übrigens schon in den 1940er Jahren erforscht wurde, lange vor Instagram & Co. Damals wie heute gilt: Menschen orientieren sich bei der Meinungsbildung nicht allein an Massenmedien, sondern vor allem an anderen Menschen, denen sie vertrauen. Heute sind das oft Social-Media-Persönlichkeiten.
Von Nano bis Giga: Die Reichweite entscheidet (nicht immer)
Influencer:innen lassen sich grob in folgende Kategorien einteilen:
- Nano: 1.000 – 10.000 Follower:innen
- Micro: 10.000 – 100.000
- Macro: 100.000 – 1 Million
- Mega: 1 – 10 Millionen
- Giga: über 10 Millionen
Interessant dabei: Nicht immer ist mehr auch besser. Gerade sogenannte Micro-Influencer:innen genießen oft ein besonders hohes Vertrauen innerhalb ihrer Nische. Für Unternehmen und Marken ist das ein beliebter Einstieg ins sogenannte Influencer-Marketing: Die gezielte Platzierung von Produkten oder Botschaften über glaubwürdige Persönlichkeiten.
Mehr als nur ein Job: Chancen und Schattenseiten
Auf den ersten Blick scheint das Leben als Influencer:in verlockend: Selbstbestimmung, Sichtbarkeit, Unabhängigkeit. Doch hinter dem Erfolg verbirgt sich oft ein hoher Preis.
Studien zeigen: Je größer die Reichweite, desto stärker der Druck. Permanente Selbstinszenierung, Community-Erwartungen und das ständige Gefühl, online „funktionieren“ zu müssen, führen bei vielen zu psychischer Belastung bis hin zur Identitätserschöpfung.
Ein Alltag zwischen Likes und Leistungsdruck, bei dem oft wenig Platz bleibt für Rückzug oder echte Erholung. Influencen ist längst kein Hobby mehr, sondern ein komplexes Berufsfeld mit echten Risiken.
Wenn Influencer:innen politisch werden
Längst beschränkt sich der Einfluss nicht mehr nur auf Konsumentscheidungen. Immer mehr Influencer:innen nutzen ihre Reichweite für politische Botschaften, sei es zu Klimaschutz, Wahlen oder gesellschaftlichen Debatten.
Das kann eine Chance sein, junge Menschen für Politik zu sensibilisieren, besonders jene, die klassische Medien weniger nutzen. Doch es birgt auch Risiken: Wenn komplexe Themen stark emotionalisiert oder ohne journalistische Standards behandelt werden, fehlt oft die notwendige Einordnung.
Die Folge: Meinung kann schnell zur Meinungsmache werden, besonders dann, wenn die Community unkritisch folgt.
Besonders sensibel: Kinder als Influencer:innen
Ein besonders heikles Feld ist der Bereich der sogenannten Kidfluencer:innen. Kinder, die auf Social Media entweder Teil des Familien-Contents sind oder eigene Kanäle betreiben, erreichen teils Millionen und sind damit oft schon im Kindergartenalter Werbeträger:innen.
Doch wer entscheidet über den Content? Wer profitiert? Und wie steht es um Privatsphäre, Selbstbestimmung und das Kindeswohl?
Rechtlich sind Kinder zwar durch das Jugendarbeitsschutzgesetz geschützt – mit klaren Regelungen zu Arbeitszeiten, Genehmigungen und gesundheitlicher Unversehrtheit. Dennoch zeigt ein aktuelles Gutachten, dass bei kommerzieller Nutzung massive Gefährdungen bestehen: Verlust der Privatsphäre, fehlende Zustimmung, dauerhafte digitale Spuren.
Empfehlung aus medienpädagogischer Sicht: Kinder unter 7 Jahren sollten nicht öffentlich gezeigt werden. Erst ab etwa 10-12 Jahren können Kinder mögliche Konsequenzen wirklich einschätzen und sollten aktiv in Entscheidungen einbezogen werden.
Verantwortung beginnt beim Verstehen
Influencer:innen haben also einen enormen Einfluss auf unser Konsumverhalten, unsere Einstellungen und manchmal sogar auf unsere politischen Überzeugungen. Sie können inspirieren, informieren und Gemeinschaft stiften. Gleichzeitig aber auch überfordern, manipulieren oder Schaden anrichten.
Was es braucht?
- Medienkompetenz – bei den Follower:innen ebenso wie bei den Influencer:innen selbst
- Gesetzliche Rahmenbedingungen, besonders zum Schutz von Kindern
- Kritische Reflexion – über Authentizität, Verantwortung und die Rolle von Social Media in unserem Leben
Denn: Nicht alles, was sich echt anfühlt, ist auch echt. Und nicht jeder Einfluss ist gut.