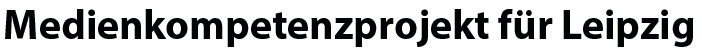Im digitalen Alltag stolpern wir regelmäßig über Begriffe wie Fake News, Desinformation oder Misinformation – doch was bedeuten sie eigentlich genau? Und wie können Sie selbst verhindern, auf Falschmeldungen hereinzufallen?
Die Begriffe im Überblick: Was ist der Unterschied?
Desinformation meint gezielt verbreitete Falschinformationen. Hier steckt eine klare Absicht dahinter, Menschen zu täuschen, zu beeinflussen oder zu manipulieren. Desinformation ist also nicht einfach ein Missverständnis – sie ist Strategie.
Misinformation dagegen bezeichnet falsche oder irreführende Informationen, die ohne böse Absicht weitergegeben werden. Wer etwa einen dubiosen Gesundheitstipp teilt, weil er „sich gut anhört“, verbreitet Misinformation – auch wenn er oder sie eigentlich helfen wollte. Oft entstehen solche Misinformationen auch durch Dekontextualisierung. Das bedeutet: Ein Zitat, ein Bild oder ein Video wird aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen und dadurch falsch verstanden oder interpretiert.
Und dann ist da noch der Begriff Fake News. Ursprünglich bezeichnete er bewusst erfundene Nachrichten, die wie echte Meldungen aussehen. Heute wird der Ausdruck jedoch häufig politisch aufgeladen genutzt – nicht zuletzt durch Donald Trump und oft, um unliebsame Berichterstattung zu diskreditieren. Deshalb ist es wichtig, zwischen den Begriffen differenziert zu unterscheiden.
Der Begriff Fake News kursierte zwar schon vor Donald Trumps erster Amtszeit, vor allem in den sozialen Medien. Doch erst durch ihn wurde daraus ein politisches Schlagwort mit Wucht und ein Kampfbegriff gegen etablierte Medien. Dabei meinte Trump mit Fake News längst nicht nur nachweislich falsche Berichte, sondern vor allem solche, die ihm nicht passten. So wurde aus dem Begriff ein Mittel, um journalistische Arbeit pauschal abzuwerten – mit spürbaren Folgen für die öffentliche Debatte.
Ein Beispiel für Trumps Umgang mit dem Begriff Fake News ereignete sich bei einer Pressekonferenz im Januar 2017, als er eine Frage des CNN-Reporters Jim Acosta scharf abblockte: „Not you, your organization is terrible. You are fake news.“ Dass diese Art des Umgangs mit Medien kein Zufall war, deutete die CBS-Journalistin Interview mit Judy Woodruff an. Sie berichtete, Trump habe ihr abseits der Kameras erklärt, dass er Journalist:innen bewusst angreife, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben: „Ich mache das, um euch zu diskreditieren, damit euch keiner glaubt, wenn ihr etwas Negatives über mich schreibt“ (Minute 21:22 bis 22:11). Auch wenn diese Aussage nicht öffentlich belegt ist, verdeutlicht sie die Strategie hinter Trumps Rhetorik. Der Begriff Fake News wurde unter seiner Präsidentschaft zu einem machtvollen Mittel, um kritische Berichterstattung pauschal abzuwehren – mit nachhaltigen Auswirkungen auf das Vertrauen in den Journalismus.
Falschmeldungen verbreiten sich rasant – leider
Eine vielbeachtete Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat gezeigt: Falschmeldungen verbreiten sich auf Social Media sechs Mal schneller als wahre Informationen. Vor allem emotionale Inhalte wie Skandale, Verschwörungstheorien oder Schreckensnachrichten lösen hohe Reichweiten aus – ganz egal, ob sie stimmen oder nicht.
So erkennen Sie Falschmeldungen
Die gute Nachricht: Sie können selbst aktiv werden. Mit ein paar einfachen Schritten lässt sich die Glaubwürdigkeit einer Meldung gut einschätzen:
- Hinterfragen statt weiterleiten
Klingt die Nachricht zu krass, um wahr zu sein? Dann lieber erst mal innehalten. Sensationsmeldungen bedienen oft starke Emotionen – und genau das macht sie so gefährlich. - Faktenchecks nutzen
Es gibt seriöse Plattformen, die zweifelhafte Meldungen überprüfen – ganz professionell und transparent. Empfehlenswerte Seiten sind: - Absender prüfen
Wer hat die Nachricht veröffentlicht? Ist es ein seriöses Medium oder ein anonymer Account mit auffällig vielen Großbuchstaben und Ausrufezeichen? - Quellen vergleichen
Wird die Information auch von anderen Medien berichtet? Gibt es eine offizielle Stellungnahme? Seriöse Nachrichten lassen sich in der Regel verifizieren. - Quellen vergleichen
Wird die Information auch von anderen Medien berichtet? Gibt es eine offizielle Stellungnahme? Seriöse Nachrichten lassen sich in der Regel verifizieren. - Bilder checken
Bilder sagen mehr als tausend Worte – aber manchmal eben auch die falschen. Nutzen Sie die Google Bilderrückwärtssuche, um herauszufinden, ob ein Bild aus einem anderen Kontext stammt oder manipuliert wurde. Das geht ganz einfach: Klicken Sie in der Google-Suche auf das Kamera-Symbol in der Suchleiste oder nutzen Sie Google Lens. Sie können ein Bild hochladen oder per Drag-and-Drop einfügen – Google zeigt Ihnen dann, wo das Bild sonst noch im Netz auftaucht.
Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass Falschinformationen sich im Netz nicht weiterverbreiten. Ein kurzer Moment der Prüfung kann helfen, sie zu stoppen und trägt dazu bei, dass das Internet ein Ort für verlässliche Informationen bleibt.